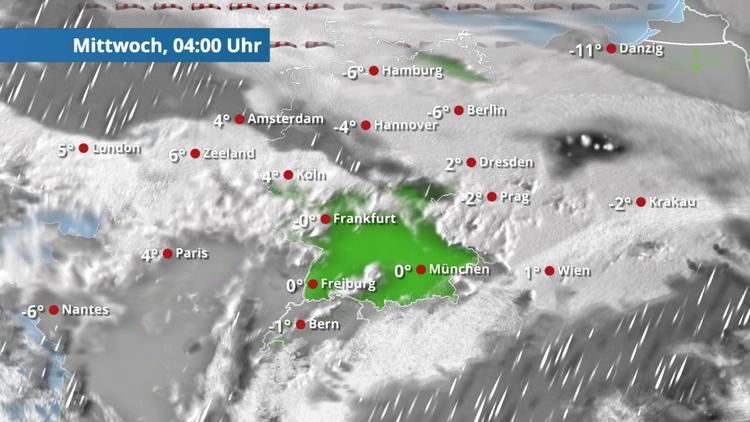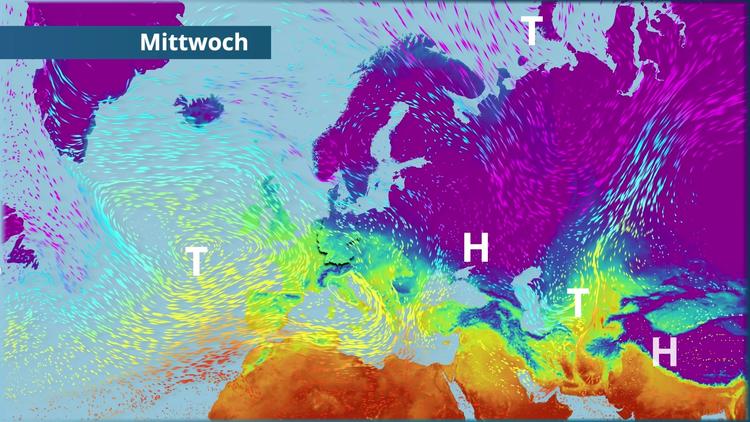Aber dafür gibt es eine Bedingung
Österreichische Wissenschaftlerin Fischer: Gletscher in Alpen können bald wieder wachsen
Es ist eine bemerkenswerte Aussage und sie stammt nicht von irgendwem, sondern von Österreichs Wissenschaftlerin des Jahres 2023 Andrea Fischer: Die Gletscher können schon bald wieder wachsen, sagt sie im Interview, das wir mit ihr beim 1. Alpenklimagipfel auf der Zugspitze geführt haben. Nur müssen wir dafür eine Bedingung erfüllen.
Im Video seht ihr, mit welchen Methoden der Gletschwschwund verlangsamt werden soll
Lese-Tipp: Felsstürze, Gletscherschwund, Starkregen: Was die Klimakrise mit den Alpen macht
Können das Schicksal wieder auf unsere Seite holen

Die Gletscher können also wieder neu entstehen, selbst wenn die Alpen zwischenzeitlich einmal komplett eisfrei werden. Daran glaubt Fischer fest. Im Interview mit wetter.de auf der Zugspitze erklärt sie uns ihren Optimismus: „Als Forscherin ist mir sehr bewusst, dass die Gletscher derzeit sehr schnell schmelzen, dass wir aber durchaus die Chance haben, dass sie wieder kommen. Bei allen Misslichkeiten des anthropogenen Klimawandels sehe ich durchaus die Chance, dass wir gegensteuern können und es uns gelingt, das Schicksal auf unsere Seite zu holen und die Gletscher wieder entstehen zu lassen“, sagt sie.
Damit das geschehen kann, müssten wir nur „endlich in die Umsetzung gehen. Wir müssen die Treibhausgasemissionen reduzieren. Wir wissen, dass es durch eine Reduzierung der fossilen Treibstoffe geschehen muss. Wir brauchen darüberhinaus einen ausgewählteren Konsum, mehr Nachhaltigkeit, eine selektivere und gezieltere Mobilität im täglichen Verkehr, privat wie im Güter- und Warenverkehr. Und eine bessere Energiebereitstellung. Mit diesen Faktoren sind wir schon so weit, dass der Zugspitzgletscher am Ende dieses Jahrhunderts wieder entstehen kann“, so die Forscherin von der Österreichischen Akademie der Wissenschaft.
Wir wissen, woher der Klimawandel kommt und was wir tun müssen
Fischer schöpft ihren Optimismus auch aus ihrer eigenen Geschichte. Denn sie begann als Bergsteigerin und endete als Glaziologin. „Als Bergsteiger werde ich immer scheitern, wenn ich denke, das geht schlecht aus, das kann ich nicht schaffen. Wenn, dann müssen wir positiv herangehen und uns sagen, dass es möglich ist. Dieser Glaube kann Berge versetzen. Und deswegen fokussiere ich mich darauf, die Herausforderungen zu meistern“, sagt sie.
„Ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist. Wir haben bessere Karten, weil wir wissen, wie wir mit dem von uns selbst verursachten Klimawandel umzugehen haben. Wir wissen, woher der Klimawandel kommt und was wir tun müssen, um die Lage zu verbessern. Vor vielen Jahrhunderten haben die Menschen einen natürlichen Klimawandel erleben müssen, die kleine Eiszeit. Die Menschen haben damals nicht gewusst, woher dieses Phänomen kommt. Wir aber haben ein politisches System, einen globalen Zusammenhalt, es gibt eine Einigkeit aller Staaten, dass wir dieses Thema angehen müssen.“
Ende der Zugspitzgletscher: Am Zugspitzplatt regiert der blanke Fels
Aber über welchen Zeitraum reden wir?

Unser heutiges Tun bestimmt die kommenden Jahrzehnte. Was wir heute an Treibhausgasen in die Atmosphäre blasen, wirkt sich noch Jahrzehnte später aus. Das weiß auch Fischer: „Die nächsten 30 Jahre sind vorausbestimmt durch unsere bisherigen Emissionen. Ab dann wird das wirksam, was wir heute und jetzt tun. Das heißt, die Alpengletscher, besonders in den Ostalpen, werden in den nächsten 30 Jahren erst einmal sehr viel kleiner werden. Dann kann es uns gelingen, wieder auf ein Temperaturniveau von heute oder früher zurückzukommen, wenn wir jetzt die richtigen Maßnahmen setzen.“
Dazu müssen wir natürlich so schnell wie möglich unser Verhalten ändern. Jede Tonne CO2, die wir emittieren, verbleibt viele Jahrzehnte in der Atmosphäre und wirkt der benötigten Kühlung somit entgegen.
Was passiert mit den Bergen, wenn der Gletscher nicht mehr da ist?

Fischer erwartet, dass die Zugspitze schon etwa 2030 eisfrei sein wird. Auch die Ostalpen werden wohl all ihr Eis verlieren. Für das Leben in den Alpen sei dies aber gar nicht so schlimm. Vorübergehend werde es zu mehr Sturzbewegungen, mehr Massenbewegungen, mehr Muren im Nahbereich der Gletscher geben. Den Siedlungsbereich sieht die Wissenschaftlerin aber dadurch nicht gefährdet.
„Wir haben auch das große Glück, dass wir in den Alpen genug Wasser aus dem Niederschlag ziehen können. Das Schöne ist, dass die Pflanzen sehr rasch nach oben rücken. Schon drei Jahre nach dem eisfrei werden, haben wir schon über 20 verschiedene Arten, auch Blütenpflanzen. Auch die Bäume kommen relativ rasch hoch. Das stabilisiert auch den Boden und reduziert die Murengefahr. So wird es zwar eine Umstellung geben, aber das sind Dinge, auf die wir uns vorbereiten können. Wir haben gute Strukturen, Management- und Gefahrenzonenpläne. Es gibt für jedes größere Fließgewässer Berechnungen, welche Höhe Schutzbebauungen haben müssen, damit der Siedlungsbereich und die Straßen sicher sind.“
Und wenn wir das Richtige tun, können wir, so glaubt Fischer, den Wendepunkt schaffen: „Wenn wir die Zusammensetzung der Atmosphäre in eine günstigere Richtung drehen, kann es durchaus zu einer langsamen Abkühlung kommen, so dass zumindest kleinere Eisfelder wieder entstehen können. Wir wissen noch nicht wie lange dieser Prozess dauern kann und wird. Das kann einige Jahrzehnte dauern. In den Ostalpen reden wir da von etwa 30 Jahren von der Flocke zum Eisblock. Der Schnee wird also an der Stelle, wo er fällt zu Eis und kann dann auch wieder zu Tal fließen“, so die 50-Jährige, die sich darauf freut „als alte Frau die Gletscher wieder wachsen zu sehen“.
(osc)