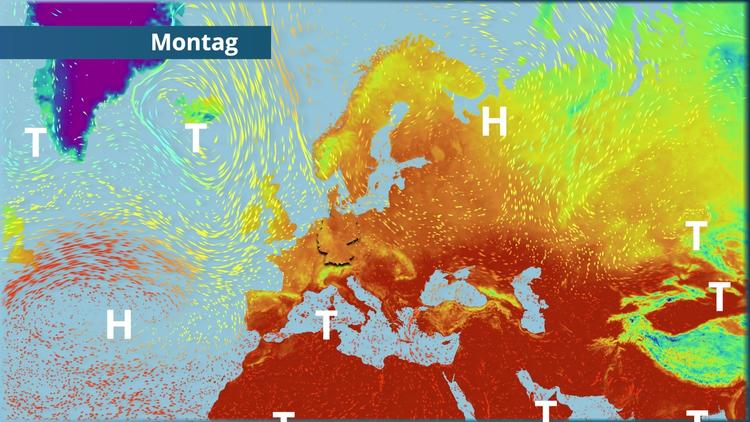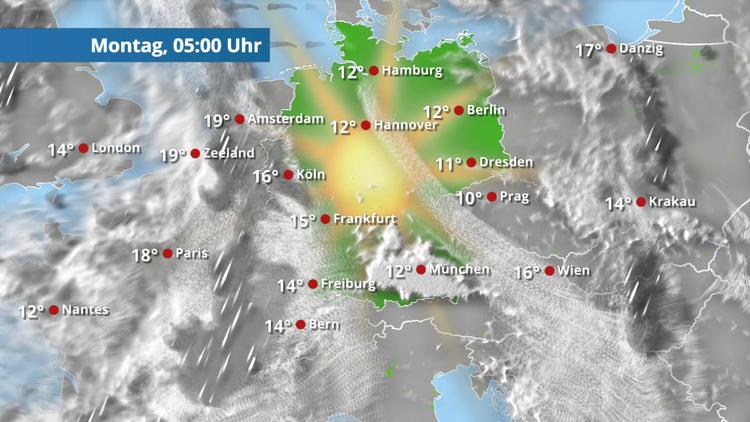25 Meter dicker Eisblock von der Größe Deutschlands ist weg
Gletscherschmelze: Wie wichtig Gletscher für unsere Wasserversorgung sind
Wasser ist Leben – das ist klar. Aber woher kommt eigentlich das ganze Wasser? Enorme Mengen spenden uns die Berge, die die Flüsse mit Wasser speisen. Doch der Zufluss wird sich verändern, wenn die Gletscher immer kleiner und weniger werden. Der Weltwasserbericht der Vereinten Nationen für 2025 zeichnet ein dramatisches Bild.
Im Video: Was passiert mit den Alpen? Die Berge im Klimawandel
Darum sind Gebirge so wichtig für unsere Wasserversorgung
Gebirge sind eine essenzielle Quelle und ein zentraler Speicher für Süßwasser weltweit. Nicht umsonst werden sie oft als die „Wasserschlösser der Erde“ bezeichnet. Warum ist das so? Weil in Gebirgen mehr Niederschlag fällt als im Flachen und weil dort weniger Wasser verdunstet. Zudem sind Gletscher eine Art Schwamm: Sie binden das Süßwasser über Jahre und geben es in warmen und gegebenenfalls trockenen Zeiten in die Flüsse ab. An den Einzugsgebieten dieser Flüsse leben mehr als drei Milliarden Menschen.
Sie benötigen das Trinkwasser für sich selbst, zum Trinken und Kochen, aber auch für die Landwirtschaft und die Industrie. „Die Erhaltung der Gletscher ist nicht nur eine ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Notwendigkeit. Es ist eine Frage des Überlebens“, sagte die Generalsekretärin der Weltwetterorganisation (WMO), Celeste Saulo. Zusammen mit den Eisschilden der Antarktis und Grönlands halten Gletscher 70 Prozent der lebenswichtigen globalen Süßwasserressourcen, teilte die WMO mit.
Was passiert mit unseren Gletschern?

In den 48 Jahren seit 1976 haben die Gletscher weltweit knapp 9.200 Gigatonnen Eis verloren, hieß es vom Welt-Gletscher-Beobachtungsdienst (WGMS) der Universität Zürich. Das entspreche einem 25 Meter dicken Eisblock von der Größe Deutschlands, so WGMS-Direktor Michael Zemp.
Der dramatische Gletscherschwund hat erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Menschen auf der Erde. Das Schmelzen der Gletscher und das Tauen des Permafrosts erhöhen in alpinen Regionen das Risiko von Bergstürzen und Ausbruchsfluten, sogenannten GLOFs (glacial lake outburst floods): „GLOFs sind Ausbrüche von Gletscherseen, welche beim Abschmelzen des Eises zurückbleiben. Lokal kann hier eine Überflutung drohen, wenn der Damm nachgibt“, so Ulrich Strasser von der Universität Innsbruck.
„Das Wasser aus dem Hochgebirge und insbesondere von Gletschern ist vor allem während trockenen und heißen Phasen äußerst wichtig. In Dürreperioden schmelzen die Gletscher besonders stark und können damit eine Lücke im Wasserangebot füllen“, sagt Matthias Huss von der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ).
Große Veränderungen in den Sommermonaten
Zukünftig wird vor allem in den Sommermonaten weniger Wasser aus Gletschern und Schnee in die Flüsse fließen. „Die Schmelzwässer der Gletscher werden weniger und gehen gegen Ende des Jahrhunderts gegen null“, sagt Andrea Fischer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck. Das hat Folgen, weniger für die Alpen, aber vielmehr für ohnehin trockenere Gebirge wie die Anden und den Himalaya.
„Diese Gebirgsregionen stehen durch die Entwicklung vor großen Herausforderungen, da die Landwirtschaft in diesen Gebieten auf die Schmelzwässer für die Bewässerungslandwirtschaft angewiesen ist“, erklärt Jan Blöthe von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
„Seit 1975 ergibt sich aufgrund der Gletscherschmelze ein kumulativer Meeresspiegelanstieg von insgesamt 25 Millimetern. Auch die regionale Wasserverfügbarkeit wird nachhaltig verändert. Die Auswirkungen machen sich also auf verschiedenen Ebenen bemerkbar: lokal, regional und global“, betont Samuek Nussbaumer vom Institut für Geographie, Universität Zürich.
Was können wir tun ohne Gletscher?

Die beste Anpassungsstrategie ist laut Strasser ein umsichtiger Umgang mit der Ressource Wasser. „Pumpspeicher sind vor allem ökonomisch interessant, der erzeugte Spitzenstrom kann gewinnbringend verkauft werden. Weniger Versiegelung und weniger Eingriffe in die Natur wären aber gute Anpassungsstrategien hinsichtlich der Wasserressourcen, und stattdessen mehr Wald, mehr ungenutzte Flächen, mehr Schutzgebiete“, erläutert der Experte.
„Die Gletscher sind große Wasserspeicher. Wenn diese Speicherwirkung verloren geht, dann könnte sie zumindest stellenweise künstlich durch neue Stauseen ersetzt werden. Nach dem Rückzug der Gletscherzungen entstehen neue Flächen, oft leblose Geröllwüsten, wo solche Speicherseen angelegt werden könnten. Dies würde eine bessere Bewirtschaftung der knapper Wasserressourcen ermöglichen“, erklärt Huss von der ETH Zürich.
„Der bessere Schutz und die Revitalisierung von Flüssen, Mooren und anderen Feuchtgebieten in Gebirgslandschaften können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Wasser kurzfristig zu speichern und verzögert über den Sommer abzugeben“, so Nussbaumer.
(osc)