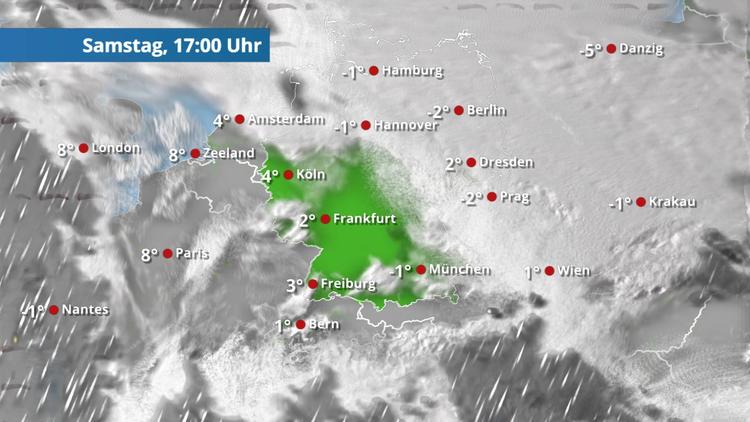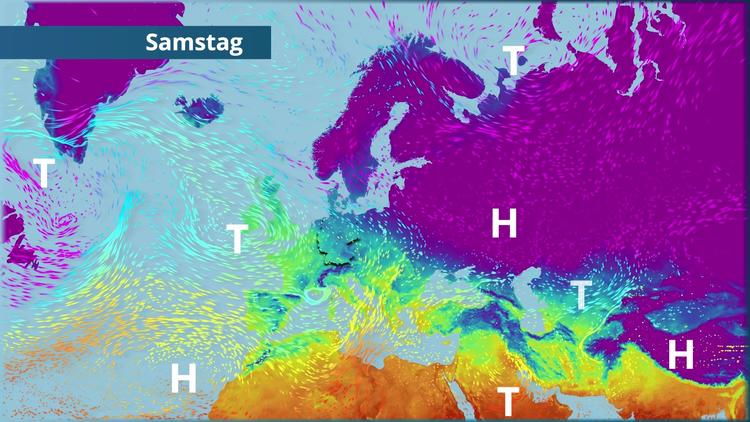Wie gelingt der Waldumbau?
Waldzustandsbericht: Unser Wald wird zum Dauerpatient - nur einer von fünf Bäumen ist gesund
Unserem Wald geht es nach wie vor dreckig. Auch der nasse Winter hat nur bedingt geholfen. Der Klimawandel setzt vielen Baumarten weiter zu. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sagte, es sei gerade einmal einer von fünf Bäumen gesund. Wie kriegen wir den Waldumbau hin? Immerhin ist rund ein Drittel Deutschlands von Wald bedeckt.
Alle News rund um das Thema Klima und Klimakrise
Mit unseren „Klima Update“-Sendungen immer informiert sein
Generationenprojekt Waldumbau

„Nur einer von fünf Bäumen ist gesund“, sagte Özdemir über die jährliche Waldzustandserhebung, bei der der Zustand der Baumkronen eingeschätzt wird. „Die Ursache ist die Klimakrise, die sich bemerkbar macht“, so der Minister. Der Wald werde zum Dauerpatienten. Nötig sei daher, dem wertvollen Ökosystem „eine Langzeitkur“ unter anderem mit einem Umbau zu mehr Mischwäldern zu verschreiben.
Nach der neuen Waldzustandserhebung für 2023 sind von den häufigsten Arten Fichte, Kiefer, Buche und Eiche vier von fünf Bäumen krank, wie das Ministerium mitteilte. Im Vergleich zu 2022 hätten sich „keine deutlichen Verbesserungen des Waldzustands eingestellt, aber auch keine deutlichen Verschlechterungen“. Bei Kiefern entspannte sich die Lage etwas, da der Anteil der Bäume mit deutlich lichteren Kronen von 28 auf 24 Prozent sank. Bei Buchen, Eichen und Fichten stieg dagegen der Anteil mit starken Kronenschäden.
Hervorragender Energiespeicher: Wie Salz ein Player bei der Energiewende wird
Waldumbau: Wie bekommen wir gesunde Mischwälder?
Einerseits müsse man die Klimakrise weiterhin mit hohem Tempo bekämpfen und gleichzeitig die Wälder zu klimaresilienten Mischwäldern umbauen. Das aber sei ein sehr langer Zeitraum: „Da reden wir über ein Generationenprojekt.“
Der fortschreitende Klimawandel bedeutet für den Wald massive Veränderungen. Lang anhaltende Trockenphasen, Hitze, häufigere Waldbrände, intensivere Herbststürme, Schadorganismen, wie zum Beispiel der Borkenkäfer, sind die Ursache für ein umfangreiches, oft großflächiges Absterben von Bäumen. Wir brauchen also Bäume, die sowohl heutige als auch künftige Klimabedingungen tolerieren. Grundsätzlich gelten Mischwälder als besonders resilient gegenüber Störungen.
Wie eine riesige Batterie: So funktioniert ein Pumpspeicherkraftwerk
Keine Chance mehr für die alteingesessenen Bäume

„Die Erwärmung wird so drastisch sein, dass tatsächlich nur wenige Baumarten, die heute gepflanzt werden, eine Umtriebszeit von 60 bis 100 Jahren im Tiefland vital überstehen dürften“, vermutet Prof. Christoph Leuschner, Pflanzenökologe der Georg-August-Universität Göttingen. „Unter den heutigen wenigen Wirtschaftsbaumarten in Mitteleuropa – vor allem Fichte, Kiefer, Buche, Eiche, Douglasie – werden vor allem die Fichte, aber in den trockeneren Tieflandregionen auch regional die Buche und Kiefer an Vitalität verlieren und erhöhte Sterblichkeiten aufweisen“, so der Experte.
„In Zukunft werden auch Feuer und biologische Faktoren wie Krankheiten, Schädlinge oder menschliche Reaktionen auf Waldschädigungen das langfristige Funktionieren von Ökosystemen auf sehr ungünstige Entwicklungspfade bringen“, urteilt Prof. Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Vor allem das Ausmaß von Dürren in Europa schreite schneller voran als gedacht.
Weg vom Nadelbaum - hin zum Laubbaum
Was also tun? „Wälder sind dynamische Systeme, die sich verändern müssen, um unter veränderten Rahmenbedingungen bestehen zu können“, erklärt Prof. Henrik Hartmann, Leiter des Instituts für Waldschutz am Julius Kühn-Institut (JKI) in Quedlinburg. „Es ist schon erstaunlich, dass viele immer noch davon ausgehen, den Wald in seiner jetzigen Form und Zusammenstellung bei sich gleichzeitig rasch und dramatisch veränderten klimatischen Bedingungen erhalten zu wollen.“
Waldbauern müssen umdenken und auf mehr Baumarten setzen, die resistenter gegen Trockenstress sind – Mischwälder mit möglichst vielen unterschiedlichen Laubbäumen. Artenreiche Mischwälder, wie sie zum Beispiel von Natur aus in Mitteldeutschland – mit fünf bis acht Arten – vorkommen oder eher vorkamen, seien bei den Waldbesitzern fast nirgends geplant, so Leuschner. „Mehr Arten im Bestand erhöhen aber die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel.“
Daher sollte die Holzwirtschaft besser auf mehr als zwei Arten pro Bestand setzen. Das muss dann auch heute wirtschaftlich wenig attraktive Baumarten wie Spitzahorn, Hainbuche, Winterlinde und Elsbeere einschließen, die deutlich trockenstresstoleranter sind. Diese etwa fünf bis zehn heimischen stresstoleranten Laubbaumarten fehlen in der heutigen Waldbauplanung weitestgehend, weil unsere Holzindustrie komplett auf Nadelholz eingestellt ist. „Hier müsste eine wahre Waldwende ansetzten und die stoffliche Holznutzung auf Laubholz umstellen“, analysiert der Experte.
Studie enthüllt: Aufforsten in Trockengebieten hilft dem Klima nicht
(osc)